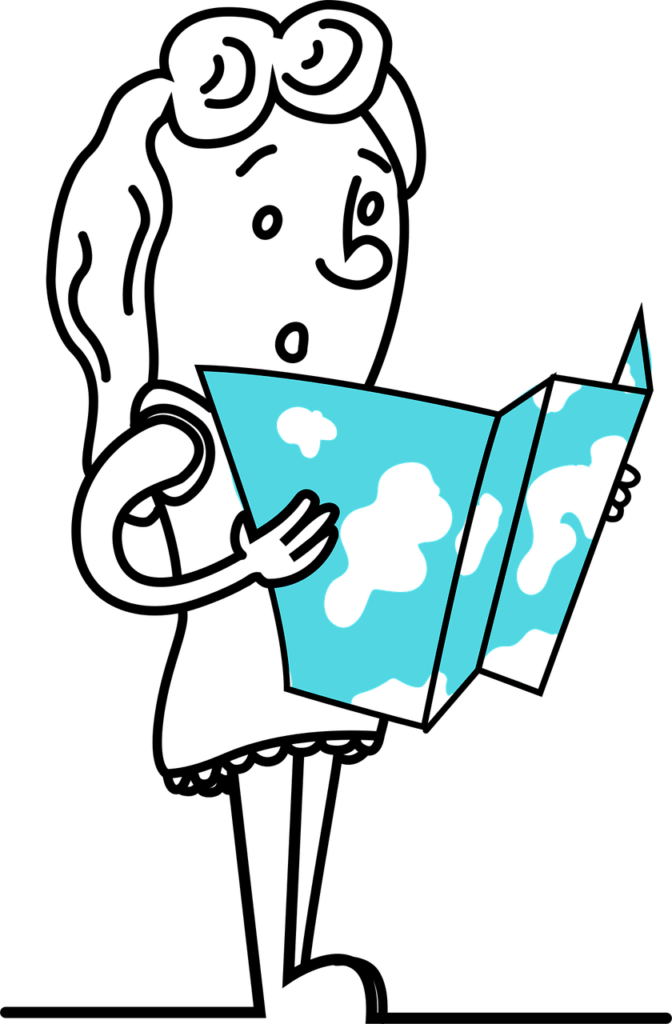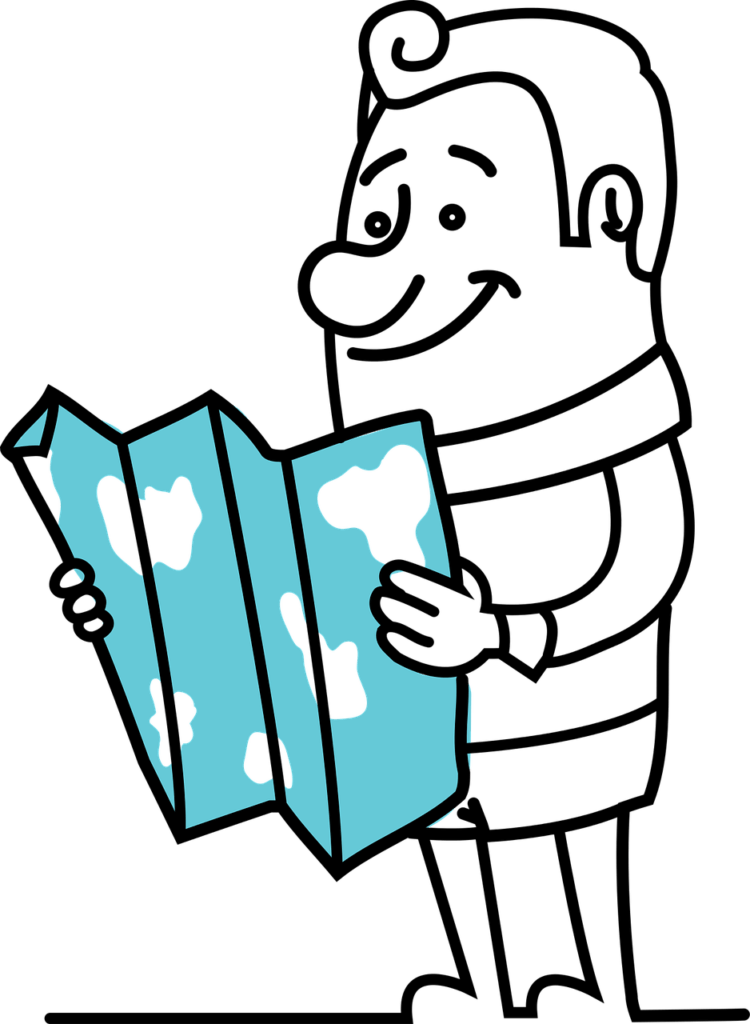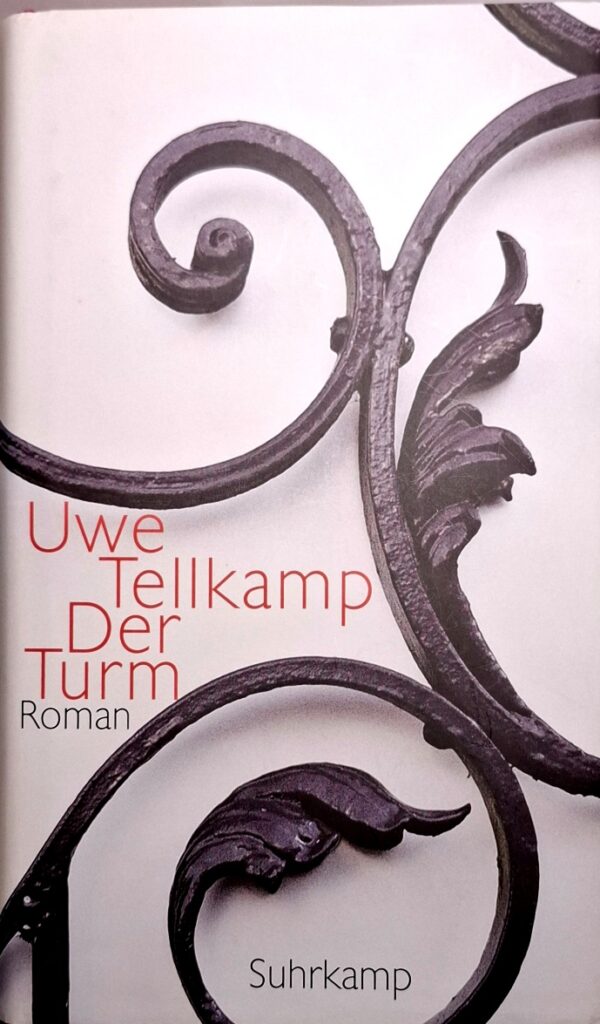

Das weiß-blaue Taubenhaus steht auf dem Grundstück Dorfstraße, Ecke Kiefernweg. Es fiel mir bei meinem ersten Spaziergang durch Fuhlendorf im Sommer 2000 auf und erinnerte mich an meine Kindheit: Freunde meines Vaters besaßen in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen ähnlichen Taubenschlag in ihrem Garten. Sie züchteten Brieftauben, nahmen an Flugwettbewerben teil und verkauften uns die weniger erfolgreichen Exemplare als Sonntagsbraten. Heute sind Tauben ebenso wie Kaninchen vom Speiseplan verschwunden. Die Zeiten ändern sich.
2008 las ich Uwe Tellkamps Roman „Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land“ und zuckte im Kapitel „Orwo schwarzweiß“ zusammen. Einer der drei Protagonisten des Romans, der Dresdner Arzt Richard Hoffmann, verbringt ab 1972 regelmäßig seine Sommerferien als Saisonarzt im Fuhlendorfer Ferienlager der Deutschen Post. Sein Blick aus einem Zimmer des Arztbungalows fällt sein auf einen „hellblauen Taubenschlag voller schneeweißer Tauben“; zu hören ist der „dauerkläffende Spitz“ auf dem Nachbargrundstück.
Ganz offensichtlich hatte also der Fuhlendorfer Taubenschlag den Weg in einen großen Roman gefunden, in dem die letzten Jahre der DDR aus der Sicht einer Dresdner Akademikerfamilie geschildert werden.
Die Eheleute Schmidt, denen Haus, Hof und Taubenschlag gehören, berichteten mir freundlich, dass der Arztbungalow nach der Wende durch das Telekom-Technikgebäude ersetzt worden sei. Errichtet worden sei das Taubenhaus durch Vater Schmidt Ende der 60-er Jahre. Es wurden dort Brieftauben gehalten, die immer dann zum Einsatz kamen, wenn Familie Schmidt ihre Tochter in Dresden besuchte. Sie nahmen ein oder zwei Tauben mit und freuten sich, wie schnell diese die lange Strecke von Dresden nach Fuhlendorf im Flug zurücklegten. Natürlich spielte bei der Taubenhaltung auch hier eine Art Selbstversorgung eine zusätzliche Rolle.
Der vielfach ausgezeichnete Roman Uwe Tellkamps ist im übrigen weiterhin lesenswert; ein literarisches Kunstwerk und gleichzeitig auch ein Zeitdokument.
Zitat aus:
Kapitel 48 ORWO – Schwarzweiß
S.661 – 665
„Hühnergötter hielten Unheil ab. Im Saisonarzt-Bungalow hingen einige über der Tür zum Warteraum, auf eine verbleichte Wäscheleine gefädelt, zwischen den Steinen durchbohrte blendweiße Muscheln. Einen abzunehmen und für später einzustecken hätte bedeutet, Glück zu stehlen, und das galt nicht; weder Christian noch Robert rührten die Kette an. Echte Hühnergötter waren schwer zu finden. Im graugelben Sand des Boddenstrands fand man leere Tintenpatronen, Glasscherben, vertrockneten Hundekot und wenn es hoch kam einen verrosteten Schlüssel; aber die weißen, von der See rundgeschliffenen Flintsteine mit einem Loch, durch das man eine Schnur ziehen konnte, waren selten. Meist war ein mehr oder minder tiefer Nabel in den Stein gehöhlt. Aufbohren galt nicht. Das Loch mußte durchgängig sein, ein Talisman-Auge für die Aussicht vom Fuhlendorfer Strand über den Bodstedter Bodden bis zum Darß, für die perlmuttweißen Kugeln, die das Badegebiet einkarrierten, den Steg mit Bootshaus, die Reusen weiter draußen, auf denen Kormorane und Möwen hockten; durchgängig für den Ostseehimmel das Schilf, in dem sich der blasshaarige, sommersprossige August wiegte.
Anne fand den Bodden zu warm, zu flach, zu unappetitlich. Kinder mit bunten Plasteimern bauten Kleckerburgen, warfen im Wasser mit Schlamm, paddelten, während ihre Mütter unter Sonnenschirmen dösten, auf Luftmatratzen und träumten, sie wären auf der Kon-Tiki, unter ihnen fünftausend Fuß Humboldtstrom voller Bonitos und Schlangenmakrelen, über ihnen Passatwolken, vor ihnen Südseeinseln. Im Bodden gab es Kaulbarsche, Plötzen, selten Aalmuttern. Für Zander brauchte man ein Boot. Robert hatte seine Angelausrüstung dabei und ging auf Friedfische, Christian nahm die Spinnrute, knüpfte das Wolfram-Vorfach an eine fünfunddreißiger Schnur grün, warf Löffelspinner und Zepp-Blinker. Kaulbarsche bissen, kleine getüpfelte Kerle mit Stachelflossen und Riesenappetit, manche waren kürzer als der Blinker, den sie für Beute gehalten hatten.
Der Saisonarzt, für drei Wochen im August hieß er wechseltäglich Richard Hoffmann, Niklas Tietze, bewohnte mit Familie den Bungalow an der Dorfstraße. Eine weiße Fahne mit rotem Kreuz wurde ausgerollt und in die Halterung neben einer mückenverklebten Lampe gesteckt. Sobald die Einwohner Fuhlendorfs, des nahen Bodstedt und der Gemeinden bis hin nach Michaelsdorf die Fahne sahen, erinnerten sie sich verschiedener Gebrechen, die den weiten Weg bis in die Poliklinik Barth nicht vertrugen, und besetzten schweigsam und befugt die mit Plastleinen bewickelten Warteraumstühle. Es gab vier Zimmer im Bungalow, davon diente eins als Praxis. Zwei WC (privat und Patienten). Die Zimmer hatten je zwei Doppelstockbetten übereck, zwei Spinde und ein Waschbecken mit Kaltwasserhahn. Wer duschen wollte, packte Badelatschen ein, nahm den Kulturbeutel und ging durch das Ferienlager der Deutschen Post, zu dem der Saisonarztbungalow gehörte, in die Duschbaracke neben der Großküche, wo man seine Siebensachen unter einen der halbblinden Spiegel im Laufgang hängte und auf gebleichten, fußpilzverdächtigen Lattenrosten in den zum Gang offenen Kabinen, von fröhlichen und schimpfenden Stimmen umgeben, auf warmes Wasser wartete. Hoffmanns fuhren seit 1972 nach Fuhlendorf, Richard teilte sich die Praxis mit Kollegen (lange war Hans dabeigewesen), konnte so seiner Familie begehrte Ostseeurlaube bieten und verdiente ein zusätzliches Monatsgehalt. Nur ein einziges Mal war es der Familie gelungen, einen Ferienplatz zu ergattern, der nicht mit Arbeit für Richard verknüpft war: Born am Darßer Bodden, in einem FDGB-Urlauberheim. Das Essen war schlecht gewesen, noch schlechter das Wetter, der Bodden in jenem Jahr voller Quallen und Tang. Wecken mit Flursirene, unabschaltbares Wand-Radio.
Dann schon lieber Fuhlendorf, auch wenn die Bungalow-Betten Roßhaarmatratzen hatten, die von Arzt zu Arzt gewendet wurden, und Stahlfederböden, an deren Widerklammern sich Richard, der unten schlief, beim Aufstehen regelmäßig die Kopfhaut aufriß. Tietzes bezogen das Zimmer 1, Hoffmanns das Zimmer 2. Es ging zur Dorfstraße, und Christian wußte, daß das ein Nachteil sein konnte, denn oft grölten Betrunkene, die vom »Nachtangeln« aus dem Café »Redensee« schräg gegenüber kamen, am Bungalow vorüber, wummerten an die Tür, verlangten Krankenschwestern und Flundern. Vor einigen Jahren war im Morgengrauen ein Soldat der sowjetischen Streitkräfte aufgetaucht, hatte mit vorgehaltener Kalaschnikow das Dienstmotorrad, eine altersschwache Zündapp, gefordert, war schlingernd davongebraust und Stunden später gefesselt, links und rechts von finster blickenden Vorgesetzten gehalten, zur Versorgung diverser Knochenbrüche zurückgebracht worden.
Fuhlendorf war Christian sofort wieder vertraut. Die Storchennester auf den reetgedeckten Bauernkaten. Der dauerkläffende Spitz im Grundstück nebenan. Der hellblaue Taubenschlag voller schneeweißer Tauben, deren Gegurr und Geflatter Tietzes gegen die Dorfstraßenrisiken wogen. Das Ferienlager mit den Dutzenden in die Tiefe gestaffelten Bungalows, aus denen Kindergesichter blickten. Die schotterbestreuten, mit weißgestrichenen Steinen gefaßten Wege, erhellt von geschweißten Fliegenpilz-Lampen. Sechs Uhr Wecken per Morgengruß aus den Lager-Lautsprechern. Einmal wöchentlich Sirenenprobe. Appelle, Besteckklappern zu vorgeschriebenen Zeiten in der Lager-Kantine. Sozialistischer Wettbewerb: Wettlauf, Fuß- und Volleyballspiele, Tischtennis auf Betonplatten, die Netze abzuholen gegen Quittung in der Lagerverwaltung. Im Sommerwind flatternde Fahnen.
Christian hatte Erholungsurlaub, den ersehnten E. U. der Armeeangehörigen. Er sprach wenig. Wonach roch es im Bungalow? Trockene Luft, Anisdrops aus der Verkaufsstelle in der Posturlauber-Kantine, die Rolle zu 24 Pfennig, die Drops immer verklebt. Es roch nach den Toiletten, auf deren Spülkästen Weberknechte hockten. Vita-Cola roch nicht, schmeckte aber, eiskalt temperiert vom brummend arbeitenden Kühlschrank des Aufenthaltsraums. Dort stand wie in den vergangenen dreizehn Jahren der »Junost«-Fernseher mit unabänderlich defekter Antenne, lieferte Fernsehen der DDR 1 und 2 sowie ein Grießbrei-Bild des Zweiten Deutschen Fernsehens, das zusätzlich Militärfunk-Ostseewellen störten. Es roch nach dem Verschalungsholz der Außenwände, dem die Winterwetter zusetzten, nach Florena-Sonnencreme, Sand, Heidekraut: Neben dem Bungalow, abgegrenzt von einem Maschendrahtzaun, ging ein Weg in ein Kiefernwäldchen. Bohnerwachs, Insektenmittel, Medikamente. Essigsaure Tonerde gegen Wespenstiche, Ankerplast-Spray als Pflasterersatz, Panthenol gegen Sonnenbrand, Sepso-Tinktur. Die Glasspritzen klirrten in den emaillierten Nierenschalen, schwitzten im Zylinder-Sterilisator Strepto- und Staphylokokken aus. Holzspatel erregten beim bloßen Anblick Würgreiz. Scheren und Skalpelle schwammen in Desinfektionslösung. Mullbinden, Gothaplast, Gummigeruch: auf der Pritsche die backsteinrote, abwaschbare Unterlage, die Klistierballons, der Tritt der beigefarben gelackten Personenwaage, zum Wiederverwenden trocknende, mit Talkum gepuderte Handschuhe. Es roch nach Brackwasser, Luftpumpenluft, nach Zitronenrauch, den Gudrun gegen all die anderen Gerüche im Bungalow versprühte
Fotos:
oben-links: Das weiß-blaue Taubenhaus || oben-rechts: Buchdeckel des Romas „Der Turm von Uwe Tellkamp“ || unten links: Die Eheleute Schmidt